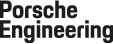Dataismus erklärt: Der Mensch als Algorithmus
Die Datenreligion
Querdenken ist der Ursprung von Porsche Engineering. Ohne unkonventionelle Idee gibt es keine Innovationen – und keinen verantwortlichen Umgang mit neuen Technologien. Darum denken wir gerne quer und lassen uns regelmäßig von außen inspirieren. Zum Beispiel von Yuval Noah Harari. Der israelische Historiker und Bestsellerautor ist einer der gefragtesten Denker der Gegenwart. Sein Buch „Homo Deus“ beschäftigt sich mit der Frage nach der Zukunft der Menschheit. Im folgenden Auszug daraus geht es um die neue „Datenreligion“, die Tiere, Menschen und Gesellschaften lediglich als verschiedene Formen der Datenverarbeitung betrachtet.
Dem Dataismus zufolge besteht das Universum aus Datenströmen, und der Wert jedes Phänomens oder jedes Wesens bemisst sich nach seinem bzw. ihrem Beitrag zur Datenverarbeitung. Das mag manchem als exzentrische Außenseitermeinung erscheinen, doch in Wirklichkeit hat sie bereits einen Großteil des wissenschaftlichen Establishments erobert. Entstanden ist der Dataismus aus dem rapiden Zusammenfluss zweier wissenschaftlicher Flutwellen. In den 150 Jahren seit der Veröffentlichung von Charles Darwins Schrift über den Ursprung der Arten haben die Biowissenschaften Organismen zunehmend als biochemische Algorithmen betrachtet. Gleichzeitig haben Computerwissenschaftler in den acht Jahrzehnten seit Alan Turings Erfindung der nach ihm benannten Maschine gelernt, immer ausgeklügeltere elektronische Algorithmen zu entwickeln. Der Dataismus bringt die beiden Entwicklungen zusammen und verweist darauf, dass für die biochemischen wie für die elektronischen Algorithmen genau die gleichen mathematischen Gesetze gelten. Damit reißt der Dataismus die Grenze zwischen Tieren und Maschinen ein und geht davon aus, dass elektronische Algorithmen irgendwann biochemische Algorithmen entschlüsseln und hinter sich lassen werden.
Für Politiker, Unternehmer und ganz gewöhnliche Konsumenten hat der Dataismus grundstürzende Technologien und ungeheure neue Möglichkeiten im Angebot. Für viele Wissenschaftler und Intellektuelle verspricht er zudem den Heiligen Gral zu liefern, der uns seit Jahrhunderten versagt bleibt: eine einzige übergreifende Theorie, die alle wissenschaftlichen Disziplinen von der Musikwissenschaft über die Ökonomie bis zur Biologie vereint. Glaubt man dem Dataismus, so sind Beethovens Fünfte Symphonie, König Lear und das Grippevirus nur drei Muster des Datenstroms, die sich mit den gleichen Grundbegriffen und Instrumenten analysieren lassen. Diese Vorstellung ist ungeheuer attraktiv. Sie verschafft allen Wissenschaftlern eine gemeinsame Sprache, überbrückt akademische Gräben und erleichtert den Export von Erkenntnissen über Fächergrenzen hinweg. Musikwissenschaftler, Ökonomen und Zellbiologen können sich endlich gegenseitig verstehen.
Im Zuge dessen kehrt der Dataismus die traditionelle Erkenntnispyramide um. Bislang galten Daten lediglich als der erste Schritt in einer langen Kette geistiger Aktivität. Man ging davon aus, dass Menschen aus Daten Informationen gewannen, Informationen in Wissen verwandelten und Wissen in Klugheit. Dataisten dagegen glauben, dass Menschen die ungeheuren Datenströme nicht mehr bewältigen können und deshalb Daten nicht mehr zu Informationen und schon gar nicht mehr zu Wissen oder Klugheit destillieren können. Die Arbeit der Datenverarbeitung sollte man deshalb elektronischen Algorithmen anvertrauen, deren Kapazitäten die des menschlichen Gehirns weit übertreffen. Dataisten sind also, was menschliches Wissen und menschliche Klugheit angeht, skeptisch und vertrauen lieber auf Big Data und Computeralgorithmen.

„Der Dataismus verweist darauf, dass für die biochemischen wie für die elektronischen Algorithmen genau die gleichen mathematischen Gesetze gelten.“
Gastautor Yuval Noah Harari
ist ein israelischer Bestsellerautor und einer der bekanntesten Historiker weltweit. Der wiedergegebene Auszug stammt aus seinem Buch „Homo Deus“ (Verlag C. H. Beck). Ebenfalls von Harari sind erschienen: „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ und „Fürsten im Fadenkreuz“.
Am festesten verankert ist der Dataismus in seinen beiden Mutterdisziplinen: der Computerwissenschaft und der Biologie. Die wichtigere von beiden ist die Biologie. Es war schließlich die biologische Übernahme des Dataismus, die aus einem begrenzten Durchbruch in der Computerwissenschaft eine welterschütternde Umwälzung machte, die womöglich die Natur des Lebens vollkommen verändert. Vielleicht lehnen Sie die Vorstellung ab, dass Organismen Algorithmen sind und Giraffen, Tomaten und Menschen nur unterschiedliche Methoden der Datenverarbeitung. Aber Sie sollten wissen, dass das gängige wissenschaftliche Lehre ist und unsere Welt gerade bis zur Unkenntlichkeit verändert.
Nicht nur individuelle Organismen gelten heute als Datenverarbeitungssysteme, sondern auch ganze Gesellschaften wie Bienenvölker, Bakterienkolonien, Wälder und menschliche Städte. Auch die Wirtschaft interpretieren Ökonomen zunehmend als Datenverarbeitungssystem. Laien glauben, die Wirtschaft bestehe aus Bauern, die Weizen anbauen, Arbeitern, die Kleidungsstücke herstellen, und Kunden, die Brot und Unterhosen kaufen. Experten betrachten die Ökonomie jedoch als einen Mechanismus, um Daten über Wünsche und Fähigkeiten zu sammeln und diese Daten in Entscheidungen zu verwandeln. […]
Die Sapiens entwickelten sich vor Zehntausenden von Jahren in der afrikanischen Savanne, und ihre Algorithmen sind schlicht und einfach nicht dafür gemacht, die Datenströme des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Wir könnten deshalb versuchen, das menschliche Datenverarbeitungssystem zu optimieren, aber das reicht womöglich nicht aus. Das „Internet aller Dinge“ könnte schon bald derart riesige und schnelle Datenströme erzeugen, dass selbst optimierte menschliche Algorithmen damit überfordert sind. Als das Auto die Pferdekutsche ersetzte, haben wir die Pferde nicht optimiert – wir haben sie in den Ruhestand geschickt. Vielleicht ist es Zeit, das Gleiche mit Homo sapiens zu tun.
Der Dataismus nimmt gegenüber der Menschheit eine streng funktionale Haltung ein und misst den Wert menschlicher Erfahrungen allein nach ihrer Funktion in Datenverarbeitungsmechanismen. Wenn wir einen Algorithmus entwickeln, der die gleiche Funktion besser erfüllt, werden menschliche Erfahrungen ihren Wert verlieren. Wenn wir also nicht nur Taxifahrer und Ärzte, sondern auch Anwälte, Dichter und Musiker durch überlegene Computerprogramme ersetzen können, warum sollte es uns kümmern, dass diese Programme über kein Bewusstsein und keine subjektiven Erfahrungen verfügen? Wenn manche Humanisten nun die Ehrwürdigkeit menschlicher Erfahrung preisen, würden Dataisten das als sentimentalen Humbug abtun. „Die Erfahrung, die Sie da in den Himmel loben, ist nichts weiter als ein veralteter biochemischer Algorithmus. Vor 70.000 Jahren in der afrikanischen Savanne war dieser Algorithmus modern. Selbst im 20. Jahrhundert war er für die Armee und für die Wirtschaft noch zu gebrauchen. Aber schon bald werden wir über viel bessere Algorithmen verfügen.“ […]
Die dataistische Revolution wird vermutlich ein paar Jahrzehnte, wenn nicht sogar ein oder zwei Jahrhunderte dauern. Aber auch die humanistische Revolution vollzog sich damals nicht über Nacht. […]
Info
Text erstmals erschienen im Porsche Engineering Magazin, Ausgabe 1/2020.
© Yuval Noah Harari
Copyright: Alle in diesem Artikel veröffentlichten Bilder, Videos und Audio-Dateien unterliegen dem Copyright. Eine Reproduktion oder Wiedergabe des Ganzen oder von Teilen ist ohne die schriftliche Genehmigung von Porsche Engineering nicht gestattet. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Kontakt
Sie haben Fragen oder möchten weitere Informationen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme: info@porsche-engineering.de